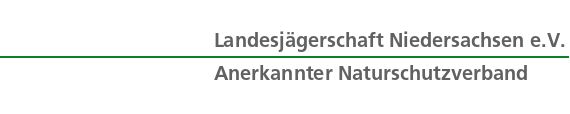Der Jagdfasan
Bejagung
Der Fasan ist in allen Bundesländern jagdbar mit unterschiedlichen, für die Hennen meist ganzjährigen Schonzeiten.
Schonende Jagdmethoden sind die Suche und das Buschieren mit Vorstehhunden, weniger schonend die Streife und das Treiben mit vielen Schützen. Es dürfen nur fliegende Vögel beschossen werden.
Beherzigenswert sind die Aussagen von SZEDERJEI u. STUDINKA (1959) über die Störungen durch den "Jagddruck": "Einer der wichtigsten störenden Faktoren sind . . . die falschen Jagdmethoden. Es gibt kein sichereres Mittel, die Fasanen aus dem Revier zu vertreiben, als dieses. Schießt man aus einem (sehr gut besetzten -Anm. Verf.) Revier 100 Fasanen auf 20 Jagden ab, so wird es ganz gewiss veröden, während man aus dem gleichen Revier an einem einzigen Jagdtag unbesorgt 200 Hahnen erlegen kann, ohne den Besatz für dauernd zu vergrämen. Es kommt also viel weniger auf die Anzahl der abgeschossenen Hähne als auf jene der Jagden an. Je weniger das Revier durch Jagden gestört wird, umso eher wird sich der Besatz halten. An ständige Störungen kann sich der Fasan nie gewöhnen . . ."
Fasanenhege
Voraussetzung für die Hege des Jagdfasans wie überhaupt des Niederwildes sind Reviergestaltung und Kurzhaltung der natürlichen Feinde, wobei ersterer die größere Bedeutung zukommt. Der Fasan benötigt wie die übrigen heimischen Hühnervogel-Verwandten einen "Biotop der kurzen Wege", d. h. Deckung und Nahrung auf möglichst engem Raum. Natürlich fördert ein solcher Lebensraum auch die Beutegreifer, allerdings ebenso deren anderweitige Beute. Bei der Reviergestaltung kann man aber die Deckung so gestalten, dass der Fasan Vorteile gegenüber den Beutegreifern hat und die Jagdausübung auf dieselben mit Falle und Waffe effektiver wird.
Bei der Hege ist Kooperation gefragt. Auf sich allein gestellt, wird der Fasanenheger in den heute meist recht kleinen Revieren scheitern, solange die Hege nicht revierübergreifend auf der Ebene von Hegering oder Hegegemeinschaft betrieben wird.
Reviergestaltung und Kurzhalten der Feinde des Fasans sind nötig, um bestehende Besätze zu erhalten oder anzuheben. Sie sind aber unabdingbare Voraussetzung für jegliche Besatzneugründungen durch Auswildern gezüchteter Fasane.
Reviergestaltung
Wir wissen heute, dass mit Ausnahme reiner Feldreviere ohne Aufbaummöglichkeiten bzw. geschlossener Waldreviere sich bis zu 70% aller Reviere für den Fasan eignen. Auswilderungsversuche haben ergeben, dass sich z. B. der Ph.versicolor bis in Höhen von 800 m über NN mehr als 10 Jahre halten kann. Voraussetzung ist ausreichende Winterdeckung hoher Heckenanteil ebenes Gelände und regelmäßige Fütterung über strenge, oft schneereiche Winter hinweg.
Betrachtet man die Niederwildreviere, erkennt man auch, woran es zumeist liegt, die oft noch in ausreichender Anzahl vorhandenen Hecken befinden sich durchweg in erbärmlichem Zustand. Sie sind meist durchgewachsen oben dicht unten licht Bodenbewuchs aus Altgras bzw. Krautschicht fehlt zum Teil ganz und somit auch die Brutdeckung für den Fasan. Was nützt ihm die Totholzhecke, wenn sich darin das ganze Jahr über die Beutegreifer Fuchs, Marder, Iltis und Katze verstecken, die Fangjagd aber aufgrund der Schonzeiten für Raubwild über Monate hinweg ruht.
Wenn die Sommerdeckung schwindet, Getreide, Hackfrüchte und Mais geerntet sind, bleibt dem Fasan nur das Feldgehölz, die Hecke oder der Wald als Zufluchtstätte. In dieser Deckung wird er den Winter nur schwer überleben, obwohl er unempfindlich gegen Kälte und Lärm am Tage ist, hat er nur seine ungestörte Nachtruhe.
Wenn er aber noch in den späten Abendstunden vom Habicht aus dem Schlafbaum geschlagen oder vertrieben wird, ist sein Schicksal besiegelt. Wo gibt es noch das raschelnde Schilf, in dem der Fasan am Boden sichere Nachtruhe findet, er den Feind am Boden Fuchs u.a. hört und abstreichen kann?
Wie wir sehen, ist es weder die Höhenlage, Witterung oder Landwirtschaft allein, die für den Rückgang des Fasans verantwortlich ist.
Der Fasanenheger sollte sich zunächst um das kümmern, was im Revier bereits vorhanden ist: Hecken und Feldgehölze pflegen! Zusammen mit den Jagdgenossen bzw. Grundeigentümern sind die Möglichkeiten dieser Maßnahmen vor Ort im Revier abzusprechen. Interesse an dieser Arbeit finden u.a. auch die örtlichen Naturschutzverbände/Gruppen, die nicht selten bei der Umsetzung in der Praxis tatkräftig mitarbeiten. Beispiele der Zusammenarbeit vor Ort an der Basis gibt es genügend!
Hecken werden im Laufe der Jahre nach und nach auf den Stock gesetzt die Sträucher werden in ca. 50 cm Höhe zurückgeschnitten. Das Reisig kann, wenn es nicht zu viel ist, liegen bleiben.
Die Stockausschläge wachsen meist gut durch, man vermeide aber Reisighaufen, in denen das Raubwild Unterschlupf findet.
Wo Hecken und Feldgehölz ganz fehlen und Möglichkeiten von Flächenankauf oder Pacht gegeben sind, sollten Feldholzinseln oder Hegebüsche angelegt werden. Langfristig gesehen dienen sie dem gesamten Niederwild, auch dem Raubwild! Gerade dort muss die Raubwildbejagung mit Flinte und Falle intensiv betrieben werden. Bei Neuanlagen verzichte man immer auf Pflanzen, die zu hohen Bäumen heranwachsen, sie dienen letztlich nur dem Beutegreifer aus der Luft! Dem Fasan reichen als Schlafbäume auch niedrige Baum- oder Buschgruppen mit einer Höhe von 3 bis 4 Metern, wie uns die Erfahrung aus der Volierenhaltung lehrt.
Zu jeder Feldholzinsel gehört auch der klassische Niederwild-Wildacker. Die Deckungsfunktion spielt hier im Bereich der Feldholzinsel eher eine untergeordnete Rolle. Fasanen sollen hier in erster Linie brüten, d. h. die Schaffung von Brutdeckung steht hier im Vordergrund. Gegen eine Maisparzelle ist nichts einzuwenden, wenngleich er als Brutdeckung nicht infrage kommt. Rotklee, Luzerne, Dauerlupine und mehrjährige Wildackermischungen sind hier besonders geeignet.
Viel zu wenig beachtet wird hier die Dauerlupine, sie erreicht um den ersten April in Süddeutschland bereits eine Höhe von über 20 cm, bis Legebeginn in der freien Wildbahn eine hervorragende Brutdeckung. Die meisten Wildackermischungen können aufgrund frostempfindlicher Pflanzen nicht vor Mitte Mai ausgebracht werden und scheiden somit als Brutdeckung im Aussaatjahr fast immer aus. Dabei ist gerade die Brutdeckung von überragender Bedeutung in Verbindung mit jenen Flächen, die zur Aufzucht der Gesperre notwendig sind.
Man könnte sie ,,Sonnungsflächen" nennen. Wo immer sich die Möglichkeit ergibt, werden kleine Flächen 400500 qm groß bereits vom zeitigen Frühjahr so kurz gehalten, dass dort kein Wildgeflügel brüten kann. Diese Flächen trocknen schnell ab, dort führt die Fasanenhenne ihr Gesperre aus, dort findet man die Huderstellen. Die Küken finden auf der kurz gemähten Fläche von Anfang an Nahrung im Überfluss.
Solche Sonnungsflächen sind ein Wildmagnet, selbst Hasen und Kaninchen und nahezu alle Vogelarten sonnen sich dort oder gehen auf Nahrungssuche. Dem aufmerksamen Jäger wird auch nicht entgehen, warum Tauben und Stare auf den frisch gemähten Wiesen einfallen. Gerade in neu gepflanzten Hecken gibt es immer wieder Fehlstellen, die man als Sonnungsflächen nutzen kann, selbst wenn sie nur sehr klein sind. Gleiches gilt übrigens für Schwarzbrachestreifen oder Krähenfüsse in Stilllegungsflächen.
Bejagung der Beutegreifer
Hat der Niederwildheger alle Möglichkeiten der Reviergestaltung ausgeschöpft, wird er sich um die intensive Bejagung des Raubwildes kümmern müssen oder er wird in der Fasanenhege scheitern.
Augenblicklich haben die örtlich sehr geringen Restbesätze an Fasanen kaum eine Chance aus ihrem Populationstief heraus zu kommen. Im Gegensatz zu den 50er und 60er Jahren haben wir heute eine ungleich höhere Beutegreiferdichte. Damals wurde das Raubwild schon wegen der hohen Balgpreise, Abschuss- bzw. Fangprämien, Beteiligung am Wildbreterlös revierübergreifend äußerst intensiv bejagt. Es war aber nicht nur die Jägerschaft, die die Fangjagd ausgeübt hat, noch intensiver wurde sie von zahlreichen Nichtjägern (Landwirte, Kleintierzüchter) aus den gleichen Gründen effektiv betrieben.
Mit dem Verfall der Balgpreise hat die Jägerschaft und der Nichtjäger als Raubwildfänger das Interesse an der Fangjagd verloren. Dies wird besonders deutlich beim Steinmarder, welcher sich ungewöhnlich stark vermehrt hat.
In den heutigen, meist zu kleinen, Revieren greift der Jagdschutz - Bejagung der Beutegreifer nicht mehr, das Raubwild aus den umliegenden Revieren besetzt unverzüglich frei gewordene Lebensräume. Dies wird besonders deutlich, wenn man innerhalb der Hegeringe die Raubwildstrecken der Reviere untereinander bei gleichen Bedingungen vergleicht. Es fällt auf, dass in manchen Revieren mehr als 10 Füchse Jahr für Jahr auf 100 ha Revierfläche erlegt werden. Andere Reviere schaffen noch nicht einmal einen Fuchs auf gleicher Fläche. Bei den Marderarten ist das Missverhältnis noch viel größer! In manchen Landkreisen liegt die jährliche Marderstrecke unter dem, was ein passionierter Fänger aus einem 500 ha großen Revier jährlich abschöpfen kann.
In Waldrevieren mit Hochwildvorkommen wird nicht selten in Erwartung dieser Wildarten fast jeder Fuchs pardoniert, obwohl man weiss, dass ein Schuss kaum stört: verhält sich der Jäger danach nur ruhig! Das Niederwild und selbstverständlich andere Bodenbrüter halten angesichts dieser Übermacht an Beutegreifern dem stetigen ,,Jagddruck" nicht stand. Besonders schwer wiegt der Riss der brütenden Hennen. Der Besatz ist angewiesen auf Junghennen mit hoher Legeleistung. Ohne die stetige Verjüngung des Stammbesatzes ist die Population nicht lebensfähig, es muss dann zur Besatzstützung ausgewildert werden. So wundert es kaum, dass heute mehr als 2/3 aller Gelege geplündert werden bzw. Hennen die Brut- und Aufzuchtzeit der Gesperre nicht überleben.
Der für den Fasan gefährlichste Feind ist einmal der Fuchs, insbesondere in der Brut- und Aufzuchtzeit, wenn die Deckung schwindet; vom Spätsommer bis in das nächste Frühjahr hinein ist es dann auch der Habicht, der neben dem Altfasan ganze Gesperre zehntet. Hinzu kommen noch der Dachs und lokal das Schwarzwild, dem kaum ein Gelege entgeht, im Wald, Feldgehölz etc., Marder, Iltis, Wiesel, Katze und die Wanderratte als Gelege- und Kükenräuber. Nicht zu vergessen die Krähen und Elstern!
Zur Zeit stellt sich die Frage der Bejagung des Habichts durch seine Vollschonung nicht, deswegen muss die Reviergestaltung bzw. Fütterung des Fasans so betrieben werden, dass die Verluste durch ihn so gering wie möglich gehalten werden. Beispiel: Hohe Bäume in der Feldholzinsel, Hegebusch etc. nutzen dem Habicht mehr als dem Fasan!
Es würde hier zu weit führen, auf die einzelnen Raubwildarten und die Methoden zu ihrer Erbeutung noch näher einzugehen. Wer dazu zu wenig praktische Erfahrung hat, dem steht eine Fülle einschlägiger Literatur zur Verfügung und er kann sich in speziellen Lehrgängen schulen oder durch Berufsjäger beraten lassen.
Aus: Merkblatt Nr. 2 des Deutschen Jagdschutz-Verbandes "Der Jagdfasan" - bearbeitet von Dr. Franz Müller und Artur Amann