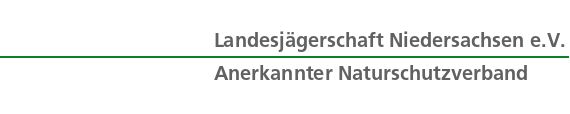Der Feldhase
Die Hasenhege besteht in Schutz und Pflege des Besatzes durch Maßnahmen, die die Verluste herabsetzen, mit dem Ziel, einen den Revierverhältnissen angemessenen optimalen Stammbesatz zu schaffen oder zu erhalten, um nachhaltig einen möglichst hohen Überschuss für die Bejagung verfügbar zu haben. Zu diesen Maßnahmen gehört vor allem der Schutz vor Feinden sowie die Verbesserung des Lebensraums durch Überhalten von Zwischenfrüchten und Unterparzellierung großer Feldschläge, ferner die Verminderung der Verluste durch Maschinen, Straßenverkehr und Krankheiten sowie die Winterfütterung und in weiterem Sinn auch die Verhinderung von Wildschäden. Das früher praktizierte Aussetzen von Hasen zur Blutauffrischung und die Hasenzucht zum Zweck der Besatzverbesserung spielen heute im Vergleich zu den anderen Hegemaßnahmen so gut wie keine Rolle mehr.
I. Schutz vor Feinden
Sprichwörtlich groß ist die Reihe der Feinde (Prädatoren), auf deren Beuteliste der Hase steht. Sie reicht vom Fuchs über Uhu, Mäusebussard, Rabenkrähe und Steinmarder bis hin zum Hermelin. Für die meisten dieser Feinde stellt er jedoch nur eine Gelegenheitsbeute dar. Keiner ernährt sich ausschließlich oder überwiegend von Hasen. Dies gilt insbesondere für gesunde, erwachsene Hasen. Bei der Interpretation ihrer Funde im Beutespektrum der Prädatoren ist zudem zu berücksichtigen, dass sich einige auch als Aasfresser oder Beuteschmarotzer betätigen, so dass nicht jeder Hasenfund unter den Beuteresten auf das erfolgte Reißen oder Schlagen eines lebenden Hasen durch sie selbst hindeutet.
Die Junghasen werden dagegen von den tierischen Fressfeinden mehr als nur gezehntet, wenngleich auch hier gilt, dass Junghasen für sie ebenfalls nur eine Gelegenheitsbeute darstellen. So ernährt sich auch der Fuchs, der als Hauptfeind der Junghasen anzusehen ist, zweifellos überwiegend von Mäusen und anderen Beutetieren. Quantitativ gesehen haben Junghasen auch für ihn gleichsam nur die Bedeutung eines "sporadischen Nachtisches". Daher gilt für keinen potentiellen Feind des Hasen, dass dieser über das Beutetier "Hase" reguliert wird, wie es bei Prädatoren der Fall ist, die nur von einem Beutetier leben, sondern es gilt in Bezug auf den Hasen vielmehr, dass dieser von den Feinden reguliert wird, und zwar bis auf eine so geringe Dichte, dass eine jagdliche Nutzung nicht mehr möglich ist, sofern die Feinde in hoher Dichte vorkommen.
Da alle Feinde des Hasen derzeit in einer so hohen Dichte vorhanden sind, wie es noch nie der Fall war, ist die Reduzierung und Kurzhaltung der Hasenfeinde, insbesondere des Fuchses, die wichtigste Hegemaßnahme. Er ist im Hasenrevier auf eine Stammbesatzdichte von nur 1 Stück pro 1000 ha zu reduzieren, wenn das Ziel einer optimalen Hasenstrecke erreicht werden soll.
In welchem Ausmaß sich die Hasenstrecke durch Kurzhaltung der Hasenfeinde steigern lässt, ist von FRANK (1970) in geradezu klassischer Weise nachgewiesen worden. Auf einer 3000 ha umfassenden Versuchfläche in der Zülpicher Börde, also in einem vom Lebensraum her für den Hasen bestens geeigneten Gebiet, stieg die Hasenstrecke nach intensi-ver Kurzhaltung der Prädatoren durch zwei Berufsjäger im Verlaufe einer Pachtperiode von 12 Stück pro 100 ha auf 48 Hasen an (siehe Abb. 12). Die Hasenstrecke konnte also vervierfacht werden auf schließlich einen Hasen pro 2 ha Revierfläche. Eine ähnlich hohe Streckensteigerung ergab sich weiterhin in anderen Revieren, in denen der Fuchsbesatz durch die erste Seuchenwelle der Wildtollwut in den 50er und 60er Jahren sprunghaft um 70 bis 80% reduziert wurde (siehe Merkblatt Nr. 6 "Der Fuchs" des Deutschen Jagdschutzverbandes e.V.).
Das Kurzhalten des Fuchses ist primär mit der Schusswaffe vorzunehmen. Dazu bieten sich neben dem Abschuss auf Treibjagden, die Pirsch und der Ansitz an sowie eine ganze Reihe spezieller Jagdarten, die neben dem hegerischen Zweck meistens noch jagdliche Freude bereiten. Zu nennen sind Drücken mit Anstehen am Pass, das Sprengen mit Bauhunden aus Natur- und Kunstbauen, das Reizen mit der Hasenquäke, das Mäuseln und der Ansitz am Luder oder am Bau. Um die erwähnte geringe Fuchsdichte zu erreichen, ist allerdings auch der Abschuss der Jungfüchse sowie der Einsatz von Fallen erforderlich, von denen sich neben der Erberswalder Jungfuchsfalle, die speziell für den Einsatz am befahrenen Mutterbau gedacht ist, die von SPITTLER (1997) entwickelte zeitgemäße Betonrohrfalle eignet (s. Merkblatt Nr. 6 "Der Fuchs" des DJV e.V.). Schwierigkeiten mit der intensiven Fuchskurzhaltung entstehen in Gebieten, wo die Jagdgrenze Wald und Feld trennt, weil die Inhaber von Waldrevieren meisten an dem Kurzhalten der Füchse nicht so interessiert sind. Gerade in solchen Fällen ist eine besonders intensive Fuchsbejagung im Felde gefordert.
Marder, Iltis und Wiesel können wegen ihrer heimlichen Lebensweise im Prinzip nur in Fallen gefangen werden. Hierzu kommen Kastenfallen und im Fangbunker gestellte Eiabzugeisen in Frage.
Früher schädigten auch Wilddiebe den Hasenbesatz mit den verschiedensten Methoden. Zu allen Jahreszeiten wurde mit Kleinkalibergewehren gewildert. Vorwiegend im Winter kam noch das Stellen von Schlingen in Zaunlücken der Gärten oder ähnlich günstigen Stellen hinzu. Besonders bei Streusiedlung wurde der für das nächste Jahr verbliebene Stammbesatz früher fast regelmäßig durch die genannten Methoden gemindert. Darüber hinaus wurde durch Totschlagen oder Totwerfen des Hasen in der Sasse früher mancher Hase still und heimlich erbeutet. Nur eine gute Jagdaufsicht vermochte den Wilddiebstahl mit Schusswaffen, Schlingen und Knüppeln zu unterbinden. Heute spielt die Hasenwilderei jedoch so gut wie keine Rolle mehr.
II. Lebensraumverbesserung
Revierverbesserung für den Hasen bedeutete früher in erster Linie Schaffung von Deckung durch Bepflanzung von Ödstellen, alten Gruben, ehemaligen Steinbrüchen, Grabenrändern und Böschungen mit schützenden Sträuchern sowie Anlage von Hegebüschen und Schutzhecken, um den Hasen vor den Unbilden der Witterung und vor Feinden zu schützen. Während die erstgenannten Maßnahmen aus Naturschutzgründen heute streng verpönt sind, wird die Anlage von Hegebüschen und Hecken nach wie vor von vielen Jägern in seltener Eintracht mit dem Naturschutz als wichtige Hegemaßnahme für den Hasen propagiert. Da der Hase jedoch von seiner gesamten Biologie her ein Tier der völlig offenen Feldlandschaft ist nicht umsonst weist er in den ausgeräumten Bördelandschaften die höchsten Dichten auf , sind diese Maßnahmen mehr für andere Niederwildarten, besonders für Fasan und Wildkaninchen zur Verbesserung der Lebensraumsituation geeignet als für die des Hasen. Wenn es darum geht, die Deckung für ihn im Winterhalbjahr zu verbessern, dann ist das Überhalten von auf das Revier verteilten Zwischenfruchtflächen bis Ende Februar des nächsten Jahres eine effektivere Maßnahme als die Anlage von Hegebüschen und Hecken, die den Revierinhabern von Pachtrevieren ohnehin nur in Ausnahmefällen möglich ist.
Zu den Zwischenfrüchten, die den Deckungsansprüchen des Hasen gerecht werden, gehören Lupine sowie Ölrettich- und Gelbsenf (Ackersenf), und zwar Sorten mit kräftiger Stängelausbildung, wie z. B. die Gelbsenfsorte Maxi, die nicht beim ersten Frost schon zusammenfallen, sondern auch bei Schnee noch Deckung bieten. Ideal ist, wenn derartige Zwischenfruchtflächen zwecks Äsungsverbesserung kombiniert werden mit Stoppelrübenstreifen oder kleinen Wildackerparzellen, bestellt mit einem hohen Anteil an winterharten Kohlarten wie Westfälischer Furchenkohl und Markstammkohl. Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang allerdings darauf, dass sich Maßnahmen zur Deckungs- und Äsungsverbesserung nur in Revieren mit zumindest einem mittleren Hasenbesatz 20 Hasen pro 100 ha lohnen, und dass man auch nicht zu viel des Guten tun darf. Wenn nämlich bei der Hasenjagd im Dezember noch viel Zwischenfruchtdeckung im Feld steht, wird es in den guten Hasenrevieren mit Herbstbesätzen von mehr als 50 Hasen pro 100 ha, die es nach wie vor gibt, schwierig, mit einmaligem Abjagen des Reviers die entsprechende Strecke zu erzielen. Wenn die Hasenjagd durch zu viel Deckung beeinträchtigt und von daher ein zweites mal auf Hasen gejagt wird, dann wirken Maßnahmen dieser Art gleichsam als Bumerang, denn vom Grundsatz her benötigt der Hase im Winter bei für ihn noch zuträglichen Feldgrößen weder einer Deckungs- noch einer Äsungsverbesserung.
Viel wichtiger als diese Maßnahmen sind für die Hege des Hasen Anstrengungen, die Feldschlaggrößen zu begrenzen, da der Lebensraum für ihn immer ungünstiger wird, je größer die Felder werden. Auch diese für den Hasen in einigen Gebieten bereits existenznotwendigen Maßnahmen entziehen sich, wie die Anlage von Hecken, der Beeinflussung durch den Jäger. Sie können nur vom wirtschaftenden Landwirt umgesetzt werden. Da jedoch große Felder in der Regel effizienter zu bewirtschaften sind als kleine, wird auf freiwilliger Basis diesbezüglich keine Besserung eintreten. Sie wird sich vielmehr nur auf dem Verordnungswege erreichen lassen.
Da eine kleinparzellierte Feldflur aber nicht nur für den Hasen von primärer Bedeutung ist, sondern für fast alle im Feld lebenden Tiere, wie Rebhuhn, Wachtel und Feldlerche, ergibt sich die Forderung nach einer Verordnung, welche die Feldschlaggrößen begrenzt, mithin nicht nur aus der Sicht der Hasen- und Niederwildhege, sie dürfte von daher auch ein Zentralanliegen des Artenschutzes sein.
Bis zu einer Realisierung dieser Forderung bleibt den Revierinhabern nur übrig, alles zu versuchen, um bei Flurbereinigungsverfahren, Ausgleichsmaßnahmen und ähnlichen Gelegenheiten auf die Erhaltung von Wegrainen, Böschungen, Gräben und anderen derartigen Landschaftsstrukturen zu drängen, da sie häufig Feldschlagvergrößerungen im Wege stehen und für das Niederwild insgesamt von Vorteil sind, wenn sie mit Dornsträuchern wie Schlehe, Weißdorn, Sanddorn, Brombeere und Wildrose undurchdringlich gemacht worden sind.
III. Minderung von Verlusten durch Maschinen, Straßenverkehr und Krankheiten
Die Hauptverluste des Hasenbesatzes entstehen durch landwirtschaftliche Maschinen, den Straßenverkehr und durch Krankheiten. Gerade die erstgenannten nehmen derzeit ein immer größeres Ausmaß an. Die naturgegebenen Verlustmöglichkeiten wie Ertrinken bei Überschwemmungen oder Verbrennen bei Bodenbränden sowie Verhungern bei Schneeverwehungen mit strengem Frost spielen dagegen insgesamt gesehen nur eine untergeordnete Rolle.
Die größten Verluste verursachen unter den landwirtschaftlichen Maschinen die Kreisel- bzw. Rotormäher. Sie bringen speziell in den Wiesenbereichen heute manchem Junghasen den Tod, wobei die Verluste nicht so sehr aufgrund der gößeren Breite und Schnelligkeit der Maschinen heute höher sind als früher, sondern primär deswegen, weil Wiesen und Weiden heute meistens viermal gemäht werden, da in erster Linie Silage geworben wird, während früher, als ausschließlich Heu gemacht wurde, nur zwei Schnitte erfolgten. Bei vier Schnitten kommen auf diese Weise nämlich mehr Junghasen um als bei zwei Schnitten. Erhöht haben sich zweifellos auch die Verluste unter den Junghasen im Rahmen der Frühjahrsbestellung der Felder sowie der Rübenernte, insbesondere wenn auch nachts gerodet wird. Zur Minderung dieser Verluste gibt es bis dato keine effizienten Methoden und Möglichkeiten.
Das Gleiche gilt für die hohen Verluste durch den Straßenverkehr. Sie machen in Deutschland ca. 100.000 Hasen pro Jahr aus. Allerdings lernen es die Hasen viel besser als die Rehe, sich auf den Straßenverkehr einzustellen. Es hat sich nämlich gezeigt, dass immer weniger Hasen überfahren werden, je stärker der Verkehr auf einer Straße ist.
Die durch den Pflanzenschutzmitteleinsatz bedingten Verluste spielen dagegen nur eine untergeordnete Rolle. Dies betrifft nicht nur die Insektizide, sondern auch die Herbizide, durch deren Einsatz zweifellos die Äsungsvielfalt für den Hasen stark eingeengt wird, und auch die Fungizide, die zu Fruchtbarkeitsstörungen führen sollen. Dass dies nicht der Fall ist, wurde durch eingehende diesbezügliche Untersuchungen nachgewiesen (SPITTLER u. FASSBENDER, 2000).
Gravierend greifen dagegen in den Hasenbesatz die Krankheiten ein, von denen es eine ganze Reihe gibt. Unter den Krankheiten, die durch Bakterien hervorgerufen werden, spielen die Hasenseuche (Pasteurellose oder Hämorrhagische Septikämie), Nagertuberkulose (Pseudotuberkulose) und Traubenkokkenkrankheit (Staphylomykose) die Hauptrolle. Sie alle verlaufen aber nicht seuchenhaft, sondern verursachen primär nur Einzelausfälle. Verlustreich verläuft dagegen die parasitäre Erkrankung der Kokzidiose, die im Sommer und Herbst bei fehlenden Schönwetterphasen insbesondere in die Junghasen stark eingreift. Althasen leiden dagegen mehr unter der Magenwurmseuche im Frühjahr. In manchen Gebieten und Jahren ist auch Lungenwurmbefall die Ursache für Fallwild im Hasenbesatz; Leberegelbefall ist dagegen selten, verläuft aber in der Regel tödlich.
In neuerer Zeit, erstmals genau im Jahr 1986, ist nicht nur lokal, sondern auch in regionaler Verbreitung eine Viruserkrankung unter den Hasen festgestellt worden, die als EBHS (European Brown Hare Syndrom) bezeichnet wird. Auf deutsch hat sich hierfür die Bezeichnung "Ansteckende Leberentzündung" durchgesetzt, da durch die betreffenden Viren massiv die Leber geschädigt wird sie zeigt eine gelbliche Verfärbung und bröckelige Struktur. Längere Zeit wurden die durch die EBHS verursachten Verluste unter den überwiegend nicht abgekommenen Althasen auf den im Jahr 1986 eingeführten Anbau von süßen 00-Raps-Sorten zurückgeführt. Sie sollten den Hasen besser schmecken als die bis dahin angebauten bitterstoffreichen Sorten, so dass man aufgrund vermehrter Aufnahme hinter den angeführten Verlusten eine Art Rapsvergiftung vermutete. Eine solche gibt es bei gesunden Hasen aber so gut wie nicht.
Die EBHS-Erkrankung zeigt zwei Verlaufsformen. In der primär vorkommenden akuten Form verenden die infizierten Hasen in wenigen Tagen. Beobachtet wurde häufig, dass sie kurz vor dem Verenden noch einmal rege wurden, ein paar hundert Meter liefen, sich dann im Kreis drehten und tot umfielen. Häufig zeigen die an der akuten Verlaufsform verendeten, nicht abgekommenen Hasen einen blutig-stark wässrig-schleimigen Nasenausfluss. Bei der subakuten Verlaufsform zieht sich die Erkrankung über längere Zeit hin; die Hasen kommen ab, machen einen deutlich kranken Eindruck und werden schließlich völlig apathisch, so dass man sie greifen kann. Wie es für Viruserkrankungen typisch ist, so führt auch die EBHS dort, wo sie auftritt, zu spürbaren Verlusten und damit deutlichen Streckeneinbußen. In der Regel erholen sich die Besätze von diesen Verlusten aber jeweils nach zwei bis vier Jahren wieder, wenn nicht noch andere Negativfaktoren, wie hoher Feinddruck, einwirkt und eine Erholung verhindert.
Vermehrt festgestellt worden ist bei den Hasen in den letzten Jahren, und zwar mit Todesfolge, eine eitrige Lidbindehautentzündung (Keratokonjunktivitis). Sie wird in ursächlichen Zusammenhang gebracht mit dem kombinierten Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln und Flüssigdünger.
Durch die RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease) = Chinaseuche, die seit Ende der 80er Jahre unter den Wildkaninchen hohe Verluste verursacht und bei der es sich ebenfalls um eine Viruserkrankung handelt die RHD-Viren sind mit denen der EBHS sehr nahe verwandt , erleiden die Hasen zum Glück keine Verluste, wenngleich bei Ihnen wiederholt Antikörper gegen die RHD-Viren festgestellt wurden.
Die Verluste durch Krankheiten variieren von Jahr zu Jahr. Die allgemeine Erfahrung lehrt, dass eine nasses Frühjahr und vor allem ein verregneter Sommer und Herbst primär für die Junghasen sehr gefährlich ist, weil sie Nässe und Kälte auf die Dauer nicht vertragen können. Vorwiegend Feuchtigkeitskrankheiten sind Magenwurmseuche, Kokzidiose und Hasenseuche. Vermutlich sind die Verluste im Sommer am geringsten, soweit es sich um ausgewachsene Hasen handelt.
Wenngleich auch zur Minderung der krankheitsbedingten Verluste unter den Hasen keine effizienten Gegenmaßnahmen ergriffen werden können, ist es doch nach wie vor von Interesse zu erfahren, an welchen Krankheiten im Revier gefundene Fallwildhasen verendet sind. Daher sollte jeder frisch tote Fallwildhase an das zuständige Veterinäruntersuchungsamt zwecks Abklärung der Todesursache eingesandt werden.
Auf den Menschen sind Hasenkrankheiten nicht übertragbar mit Ausnahme der Nagerpest (Tularämie), der Brucellose und der Tollwut. In Deutschland sind alle drei genannten Krankheiten bisher aber nur in wenigen Fällen festgestellt worden. Die Übertragung der erstgenannten Erkrankung erfolgt über Hautwunden und Schleimhäute durch Körperflüssigkeit tularämiekranker Hasen. Krankheitserscheinungen beim Menschen sind Erbrechen, Kopfschmerzen, Fieber und Geschwürbildungen. Tollwütige Hasen wurden nur in sehr geringer Zahl bei dem ersten Seuchenzug der Wildtollwut nach dem zweiten Weltkrieg ermittelt.
Naturgemäß treten Krankheiten dort häufiger auf, wo die Besatzdichte der Hasen sehr hoch ist. Aufgabe der Hege ist es, die Verluste so niedrig wie möglich zu halten. Zu den Maßnahmen unter diesem Aspekt gehören folgende:
Fallwild muss, sofern es nicht zur Untersuchung auf die Todesursache an ein Veterinäruntersuchungsamt eingesandt wird, durch tiefes Vergraben möglichst schnell beseitigt werden. Keinesfalls darf es auf Misthaufen oder in Gewässer geworfen werden. Kranke Stücke sind frühzeitig aus dem Bestand zu entfernen. Sie sind an langsamen Bewegungen, Krümmung des Rückens und übermäßig festem Drücken zu erkennen. Vom Hund lassen sie sich leicht greifen. Durch die frühzeitige Entfernung von kranken Stücken wird nämlich die Ansteckungsgefahr erheblich herabgesetzt.
Weiterhin ist eine Verminderung der Wildkaninchen angezeigt, wenn eine Krankheit auftritt, deren Erreger auch bei diesen vorkommt, wie z. B. die Magenwurmseuche und Kokzidiose.
Futterplätze und Wildäcker sind einigermaßen gleichmäßig über das Revier zu verteilen, um zu vermeiden, dass sich die Hasen an wenigen Stellen konzentrieren, wodurch naturgemäß die Gefahr einer Infektion mit Krankheiten zunimmt.
Theoretisch ist an dieser Stelle auch der Einsatz von Medikamenten anzuführen. Sowohl zur Bekämpfung der Wurmarten beim Hasen als auch zur Bekämpfung der Kokzidiose gibt es nämlich wirksame Präparate. Bezüglich ihrer Wirksamkeit beim Einsatz unter den Bedingungen der Revierpraxis liegen bisher jedoch keine überzeugenden positiven Befunde vor. Damit diese Mittel, die beim Tierarzt zu erfragen und über ihn zu beziehen sind, helfen können, müssen sie jedoch in einer bestimmten Mindestmenge und bei den Mitteln gegen die Kokzidiose zusätzlich noch über einen bestimmten Zeitraum, in der Regel über eine Woche, den einzelnen Hasen verabreicht werden. Dies ist draußen im Revier aber kaum zu erreichen, so dass diese Maßnahme allein von daher nicht empfohlen werden kann, abgesehen von der grundsätzlichen Problematik des Einsatzes von Medikamenten in der freien Wildbahn.
Im Zusammenhang mit den Maßnahmen zu Minderung der Krankheiten beim Hasen ist noch anzumerken, dass Hasen gelegentlich im Gescheide die Finnen des gesägten Hundebandwurms enthalten sowie in den Muskeln die Finne einer Quesenbandwurmart. Rohes Gescheide oder Muskelfleisch sollte deshalb vor dem Genossenmachen von Jagdhunden auf das Vorhandensein von Finnen eingehend geprüft werden.
Anzeigepflichtig ist von allen Hasenkrankheiten nach dem Viehseuchengesetz lediglich die Tularämie und die Brucellose.
IV Winterfütterung
Im Allgemeinen bedarf es keiner Fütterung des Hasen. Selbst im Winter ist ein Hungern nicht zu befürchten, sofern das Wetter offen ist. Notzeit tritt erst ein, wenn der Schnee meterhoch liegt oder längere Zeit von einer Eiskruste bedeckt ist, die es dem Hasen unmöglich macht, an die Äsung heranzukommen. Dann ist es nicht allein der Mangel an Äsung, sondern vor allem der Mangel an Wasser, der den Besatz gefährdet, weil die Hasen von Ausnahmen abgesehen kein Wasser schöpfen, sondern ihren Wasserhaushalt vollkommen aus den in der Äsung enthaltenen Pflanzensäften decken. Das Anbieten von Trockenfutter ist deshalb zwecklos und sogar gefährlich. Die Bemühungen des Hegers müssen vielmehr darauf gerichtet sein, den Hasen wasserhaltige Äsung zugänglich zu machen.
Da die Winter insgesamt milder und schneeärmer geworden sind und die besseren Hasenreviere schon immer in offenen Feldgebieten lagen, in denen der Wind den Schnee zum Teil wegweht, so dass offene Saatstellen entstehen, hat der unter dem Aspekt der Winterfütterung immer erwähnte Einsatz des Schneepfluges zum Freilegen der natürlichen Äsung lediglich lokale Bedeutung.
Das gleiche gilt für das Ausbringen von Obstbaumschnitt, wenngleich der Hase Knospen und zarte Rinde sehr gern äst, insbesondere von Kirsche und Apfel. Sinnvoll zur Vorbeugung von Nageschäden ist dagegen der Einschlag von Prossholz wie Weiden, Aspen, Eschen, Ahorn, Akazie und Hainbuche.
Die eigentliche Fütterung erfolgt primär mit Rüben aller Art wie Zucker-, Futter- und Mohrrübe und gelegentlich mit Kartoffeln, die aber nicht in Haufen ausgelegt, sondern einzeln über das Revier verteilt werden. Für diese Stellen sollten geschützt liegende Bereiche ausgesucht werden. Es darf nie zuviel Futter auf einmal ausgelegt werden, sondern es sollte dafür häufiger gefüttert werden, und zwar so lange die Schnee- bzw. Frostperiode andauert. Die Aufnahme gefrorenen Futters ist nicht gesundheitsschädlich. Als "Beifutter" können Kohl- und Wurzelgemüsereste sowie kleine Bündel von gutem Heu gereicht werden.
Schließlich ist in den besseren Hasenlagen der Reviere die Anlage von Wildäckern empfehlenswert mit einem hohen Anteil von winterharten Kohlarten sowie das Überhalten von als Zwischenfrucht eingesäten Stoppelrüben. Große Flächen sind hierzu nicht erforderlich. Optimal ist vielmehr eine kleinparzellierte Verteilung dieser Flächen über das gesamte Revier.
Aus Merkblatt Nr. 5 des Deutschen Jagdschutz-Verbandes "Der Feldhase" , neubearbeitet von Dr. H. Spittler